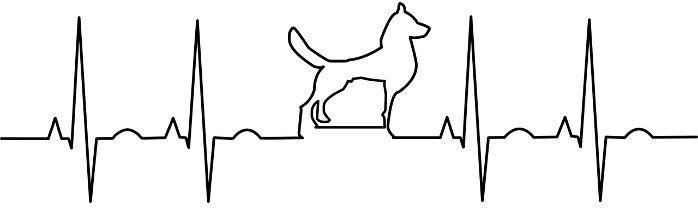Australian Cattle Dog » Rassebeschreibung
Widerristhöhe: Rüden: 46 – 51 cm / Hündinnen 43 – 48 cm
Gewicht: beide bis ca. 25 kg
Lebenserwartung: 12 – 15 Jahre
Herkunft: Australien
Art: Hütehund / Treibhund
Charakter: der Australian Cattle Dog ist arbeitswillig, selbstbewusst, intelligent, aufmerksam, lernwillig
Farben: blau und loh, rot in verschiedenen Variationen
Verhalten und Wesen vom Australian Cattle Dog
Der Australian Cattle Dog ist ein äußerst arbeitswilliger Hund. Er bringt sehr viel Energie mit sich und braucht dabei die tägliche Auslastung.
Er macht alles für sein Herrchen, wobei ihm eine feste Rangordnung in seinem Rudel eine große Rolle spielt. Fremden sowie auch anderen Hunden gegenüber ist der Treibhund eher misstrauisch, weshalb die Rasse auch heute noch vermehrt als Wachhund eingesetzt wird.
Ursprung und Geschichte
Der Australische Treibhund ist unter vielen verschiedenen Namen bekannt. Dazu zählen zum Beispiel
- „Red Heeler“,
- „Blue Heeler“
- oder „Queensland Heeler“.
Heute ist der Hund unter „Australian Cattle Dog“ bekannt, was übersetzt so viel wie Australischer Viehhund (Treibhund) bedeutet.

Bei den früheren Siedlern von Australien wurden Hunde, die dem Old English Sheepdog ähnelten, für das Treiben der Kühe eingesetzt.
Da diese Hunde aber nicht für das heiße Klima Australiens geschaffen waren, importierte der Rinderzüchter Thomas Hall im Jahr 1830 sogenannte Drovers Dogs aus Nordengland. Die blau gepunkteten Hunde kreuzte er mit den einheimischen Dingos, woraus einige Jahre später der sogenannte Hall’s Heeler entstand.
Diese Hunde waren hitzebeständig und in der Lage, über Hunderte von Kilometern die dort lebenden Rinderherden einzutreiben. Da die Hunde auch unbestechliche Wachhunde waren, wurden bis zum Tod von Thomas Hall im Jahr 1870 keine der Hunde verkauft.
Erst einige Jahre später wurden noch andere Rassen wie zum Beispiel der Australian Kelpie eingekreuzt, um das Aussehen der Treibhunde zu optimieren. Welche anderen Hunde noch eingekreuzt worden sind, ist bis heute nicht geklärt. Im Jahr 1903 wurde der erste Standard von Robert Kaleski für den ACD aufgestellt.
Haltungsempfehlung
Der Australian Cattle Dog ist nicht als Anfängerhund geeignet, da er jede Unsicherheit und jeden kleinen Fehler ausnützen würde.
Die Rasse braucht aufgrund seiner verschiedenen Charakterzüge eine sehr konsequente aber trotzdem liebevolle Erziehung. Diese gestaltet sich mit einer sicheren Führung in der Regel sehr einfach, da der Australian Cattle Dog einen ausgeprägten Lernwillen hat.
Als reiner Familienhund ist der Australian Cattle Dog eher weniger geeignet. Er braucht täglich eine Aufgabe, welcher er nachgehen kann. Ansonsten fühlt er sich schnell unterfordert und sucht sich aus Eigeninitiative eine Arbeit. Dieses Verhalten ist auf seine früher selbstständige Arbeitsweise als Treibhund zurückzuführen.
Die tägliche körperliche sowie geistige Arbeit mit dem Hund ist deshalb sehr wichtig. Aufgrund seines hohen Bewegungsdrangs ist es aber auch sehr wichtig, dass der Rasse bereits im Welpenalter Ruhe beigebracht wird.
Beschäftigungsmöglichkeiten
Der Australian Cattle Dog eignet sich aufgrund seiner unerschöpflichen Energie für nahezu jede Sportart sowie auch für Joggingrunden, Fahrradtouren und ähnliche Aktivitäten.
- Agility
- Discdogging
- Hoopers
- Flyball
- Obedience
- ect.
Auch bei verschiedenen Ausbildungen ist der Australian Cattle Dog oft und gerne gesehen:
- Begleithund
- Therapiehund
- Rettungshund
Krankheiten
Es gibt verschiedene Krankheiten, die vermehrt beim Australian Cattle Dog anzutreffen sind. Viele davon können durch eine seriöse Zucht verhindert werden.
Cystinurie
Bei einer Cystinurie handelt es sich um eine erbliche Stoffwechselerkrankung. Dem Hund fehlt ein bestimmtes Transportprotein, wobei es zu Nieren- und Blasensteine sowie ein lebensbedrohlicher Verschluss der Harnwege kommen kann. Mehr Infos über Cystinurie findest Du hier.
Degenerative Myelopathie (DM)
Eine Degenerative Myelopathie ist eine fortschreitende Rückenmarkserkrankung, welche bei älteren Hunden auftritt. Es handelt sich um eine neurologische Erkrankung, die die Zerstörung der Nervenhülle im Rückenmark bewirkt.
Hunde, die an dieser Erkrankung leiden, können die hinteren Beine nicht mehr richtig koordinieren. Sie heben die Pfoten nicht mehr korrekt und die Reflexe nehmen mit der Zeit ab. Die Krankheit führt letztendlich zu einer kompletten Lähmung der hinteren Gliedmaßen.
Diffuse idiopathische Skeletthyperostose (DISH)
Bei der diffusen idiopathischen Skeletthyperostose handelt es sich um eine vererbbare, nicht entzündliche Erkrankung, die den Bereich der Wirbelsäule betrifft. Dabei kommt es zu einer Verknöcherung diverser Bänder und Sehnen. Dies führt zu starken Schmerzen im Bereich der Wirbelsäule und zu Bewegungseinschränkungen.
Die Krankheit ist sehr ähnlich wie die Spondylose deformans aufgebaut. Der Unterschied liegt darin, dass eine DISH genetisch bedingt auftritt und die Spondylose durch Überlastung, Abnutzung und Verschleiß entsteht.
Ellbogendysplasie (ED)
Bei der Ellbogengelenksdysplasie handelt es sich um eine Fehlbildung des Ellbogengelenkes. Dieses ist aufgrund starker Belastung, einer extremen Wachstumsphase, falscher Ernährung, zu intensiven Spaziergängen oder übermäßigem Steigen von Treppen überlastet.
Symptome dafür sind dann Anzeichen einer Lähmung oder eine merkwürdige Auswärtsstellung der Vorderpfoten. Mehr Infos über Ellbogendysplasie findest Du hier.
Hüftgelenksdysplasie (HD)
Bei einer Hüftgelenksdysplasie sitzt die Gelenkkugel nicht richtig in der Gelenkpfanne, was zu erheblichen Problemen und Schmerzen führen kann.
Die Krankheit ist erblich bedingt und bereits bei vielen Hunderassen anzutreffen. Ist die Erkrankung genetisch bedingt, lässt sich diese durch eine ausgewogene Ernährung vorbeugen. Mehr Infos über Hüftgelenksdysplasie findest Du hier.
Hyperurikosurie (HUU)
Hierbei handelt es sich um eine genetisch bedingte Krankheit, welche zu einer verstärkten Ausscheidung von Harnsäure im Urin führt. Der Körper kann dabei den Überschuss nicht verarbeiten. Deshalb kommt es zu Kristallbildungen, welche wiederum zu Blasensteinen führen. Diese müssen dann vom Tierarzt in den meisten Fällen operativ zu entfernen. Mehr über die Hyperurikosurie findest Du hier.
Linsenluxation (LL)
Bei einer Linsenluxation löst sich die Linse des Auges aus ihrer Position. Sie beginnt sich dann im Augeninneren frei zu bewegen. Bei der Krankheit unterscheidet man zwischen zwei verschiedenen Arten:
Die primäre Linsenluxation (PLL): genetisch bedingt, entsteht ohne Vorerkrankung
Die sekundäre Linsenluxation: entsteht aufgrund einer Vorerkrankung (Katarakt, Glaukom, Uveitis ec.)
Progressive Retina Atrophie (PRA)
Hierbei handelt es sich um eine vererbte Netzhauterkrankung, welche in jedem Fall zu einer Erblindung führt. Grund dafür sind die sogenannten Fotorezeptoren, welche nicht mehr korrekt funktionieren.
Dadurch wird die Netzhaut dünner und es kommt zum Verlust des Sehvermögens. Mehr Infos über PRA findest Du hier.
Taubheit
Ist der Hund von einer Taubheit betroffen, unterscheidet man zwischen zwei verschiedenen Arten:
Die sensorineurale Taubheit:
Das Innenohr eines Hundes besteht aus der sogenannten Schnecke, der Cochlea. Diese ist mit kleinen feinen Haarzellen ausgestattet, welche für die Schallübertragung zuständig sind.
Ist dieser Mechanismus gestört, werden die Signale nicht bis hin zum Gehirn geleitet und es kommt zu einer Degeneration und Zerstörung der Innenohrstrukturen. Die Folge davon ist eine ein- oder beidseitige Taubheit.
Die konduktive Taubheit:
Diese Art von Taubheit entsteht durch einen Defekt im äußeren Gehörgang des Mittelohres. Schuld daran ist meistens eine Tumorbildung oder eine chronische Ohrenentzündung (Otitis).
Ebenfalls oft gelesen:
Hier die neuesten Artikel über Hunderassen in Luckys-Welt:

Schnoodle: Rassebeschreibung der Kreuzung zwischen Schnauzer und Pudel
Schnoodle » Rassebeschreibung des Hundes mit Herkunft und Ursprung, Wesen Krankheiten, Haltungs-Empfehlungen und vielen Tipps.

Der Labradoodle: Beschreibung der Rasse
Hier gibt es viele Infos über Charakter, Herkunft, Haltungspflege und vieles mehr. Wichtige Fakten zur Hundereasse Labradoodle.

Der Goldendoodle: Rassebeschreibung der perfekten Kreuzung zwischen Golden Retriever und Pudel
Hier finden Du hilfreiche Infos und Tipps zum Charakter, der Haltung und der Erziehung der Hunderasse Goldendoodle.

Elo: Rassebeschreibung
Elo » Rassebeschreibung des Hundes mit Herkunft und Ursprung, Wesen Krankheiten, Haltungs-Empfehlungen und vielen Tipps.

Alaskan Malamute
Hier findest Du hilfreiche Infos und Tipps zum Charakter, der Haltung und der Erziehung der Hunderasse Alaskan Malamute.